V. ADDENDA
1. Horst Langer: Über Sibylla Schwarz (1621-1638)
2. Sibylla Schwarz, Das
schnöde Tun der Welt
 |
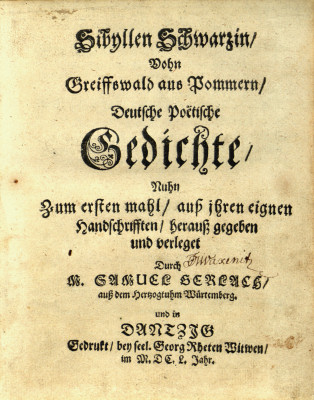 |
Vorbemerkung zu Hans-Jürgen Schumacher: ... die Lieb' ist mein Beginn. Sibylla Schwarz - Eine Dichterin in Pommern. Romanbiographie. Mesekenhagen 2007.
Im Spätsommer 1634 wird Sibylla Schwarz eingeladen,
bei einer Festlichkeit zu Ehren des Greifswalder Ratsherrn Johann Glewig
aus ihren Gedichten zu lesen. In der Stadt hatte sich herumgesprochen,
dass die Tochter des Bürgermeisters, sie ist gerade dreizehn, in
ihren "Nebenstunden" Poesie verfasste - mehr als ungewöhnlich
in einer Zeit, deren männlich dominierte Gesellschaft sich einig
war in dem Urteil: Lieber ein bärtiges als ein gelehrtes Frauenzimmer!
Noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts sah sich der Dichter und Poetiklehrer
Daniel Georg Morhof aus Wismar zu der Feststellung veranlasst: "Es
ist gar ein unbilliges Urteil des vornehmen arabischen Poeten Pharezdaki,
welcher gesagt, wenn die Henne wie der Hahn singet / muss man ihr den
Hals abschneiden." Dass Sibylla dennoch die Einladung in das Haus
des Ratsherrn erreichte, war zwei Gründen geschuldet: Zum einen verlieh
die Anwesenheit der Dichterin aus patrizischer Familie dem Fest zusätzlichen
Glanz, zum anderen konnte die Lesung den Gästen willkommene Gaudi
bringen.
Als Sibylla endlich an der Reihe ist, sind viele Zuhörer bereits
alkoholisiert. Mit glühenden Wangen trägt die Poetin ihre kunstvoll
geformten gedankenschweren Verse vor. Als sie endet, herrscht betretenes
Schweigen. Zunächst hinter vorgehaltener Hand, sodann ganz unverblümt
brechen Unverständnis und Distanz hervor. "Weiber sollten sich
erst gar nicht mit diesen Dingen befassen!", ruft einer der Gäste
aus, und ein anderer bekräftigt: "Weiber, die womöglich
studieren wollen, kann niemand wirklich mögen." Auch Sibyllas
geistlicher Beistand Christoph Hagen zeigt kaum Verständnis für
seinen Schützling, entgegnet dem Mädchen mit Blick auf die Männersache
Dichtkunst: "Gewisse Dinge sollten für alle Zeiten bleiben,
wie sie sind."
So wie in Hans-Jürgen Schumachers Romanbiographie vor Augen geführt,
kann es gewesen sein. Wiederholt finden sich in Sibyllas Texten Anhaltspunkte
für eine entsprechende Lesart. Freilich ist damit nur eine, wenn
auch eine gewichtige Schwierigkeit ihrer Schreib- und Lebenssituation
bezeichnet. Eine weitere Hürde ergab sich für die jugendliche
Autodidaktin aus dem komplizierten Literaturverständnis ihrer Gegenwart.
Anders als zu anderen Zeiten, folgte die Dichtkunst im 17. Jahrhundert
strengen Regeln. Deren Verfasser, allen voran der berühmte schlesische
Autor und Poetik-Lehrer Martin Opitz, orientierten sich an der kunstbewussten
lateinischen Literatur des europäischen Humanismus. In der Absicht,
qualitative Ebenbürtigkeit mit dieser zu erlangen, übertrugen
sie deren Normen auf den muttersprachlichen Meridian. Entsprechend wurden
für die Gattungen und Genres Strukturen bestimmt, denen buchstabengetreu
folgen musste, wer in den Musenberg aufsteigen wollte.
Sibylla mag zehn, elf Jahre gewesen sein, als sie Opitz'
wegweisendes Buch von der Deutschen Poeterey erstmals in Händen
hielt. In ihm werden Wesen und Eigenschaften der Poesie "gründlich
erzählet und mit Exempeln ausgeführet". Aus ihren Notizen
wissen wir, dass die Greifswalderin den Band wie im Rausch verschlungen
und sogleich versucht hat, eigene Gedanken über Gott und die Welt
in die Gestalt der vorgeschriebenen Formen zu bringen - etwa in die des
hoch gepriesenen Alexandriners, den Opitz so charakterisierte: "Der
weibliche Vers hat dreizehn, der männliche zwölf Silben [...]
Es muss aber allezeit die sechste Silbe eine Zäsur oder (einen) Abschnitt
haben, das ist: entweder ein einsilbig Wort sein oder den Akzent in der
letzten Silbe haben." Keine leichte Aufgabe für eine Zehn-,
Elfjährige, die sie wieder und wieder bravourös meisterte.
Die wenige Zeit, die Sibylla für ihre literarischen Exerzitien blieb,
lag vor allem in den Abend- und Nachtstunden - nach Erledigung vielfältiger
häuslicher Pflichten. In einem Brief weist sie darauf hin, "dass
die Poesey eine Verursacherin vieles Guten bei mir gewesen/ und ich sie
derohalben [...] füglich also beibehalten kann/ dass dadurch andere
Geschäfte nicht hintan gesetzt" würden. Zudem gab es, von
gelegentlichen Gesprächen mit ihrem Lehrer Samuel Gerlach sowie Bruder
Christian abgesehen, kaum eine Möglichkeit zum gedanklichen Austausch
mit Gleichgesinnten. Immerhin lag Greifswald trotz seiner Universität
eher am Rande der zeitgenössischen res publica litteraria. Wie sich
zeigen sollte, hatte Sibylla keinen geringen Anteil daran, den Namen ihrer
Heimatstadt in der gebildeten Welt zu verbreiten - allen entgegenstehenden
Voraussetzungen zum Trotz: dem kindlichen Alter der Dichterin, ihrem benachteiligten
Geschlecht, dem Druck familiärer Aufgaben sowie dem Fehlen bestätigender
Resonanz.
In der Summe der Widerstände fast unüberwindliche Barrieren
für die Heranwachsende, zumal angesichts ihrer fragilen Gesundheit.
Dennoch erscheinen die umrissenen Probleme eher geringfügig - gemessen
an Herausforderungen, denen sich Sibylla gegenüber sieht, als der
dreißigjährige Krieg Greifswald und seine Umgebung erreicht.
Nächst dem frühen Tod der Mutter fügen ihr die Orgien von
Gewalt und Zerstörung, die vor ihren Augen stattfinden, unheilbare
Wunden zu - nicht zuletzt die Vernichtung ihres "Freudenorts"
Fretow (Frätow), eines ländlich-idyllischen Refugiums der Familie
Schwarz vor den Toren der Stadt. In einer zuversichtlicheren Stunde notierte
sie: "Ist schon die ganze Welt im Blute durchgenetzet/ So bleibt
doch etwas noch/ damit man sich ergötzet [...] Da auch der Musen
Sinn/ und Geist die Flügel kriegt/ Das Feld/ da Freundschaft blüht/
die Kummerwenderin." Diesen wirklichen wie literarischen Ort hatte
Sibylla wieder und wieder als Stätte der Begegnung und fröhlicher
Ausgelassenheit erfahren, "die der Städte Volk nur gänzlich
meiden muss", als einen Ort, aus dem sich Unaufrichtigkeit, Neid
und Missgunst strikt verbannt sahen. Im Angesicht seines Untergangs vergegenwärtigt
die Dichterin sich sowie den "Freunden und Mitgenießer(n)"
in erschütternden Bildern ihren Fall aus dem Reich der Glückseligen
ins Bodenlose der trist-brutalen Kriegswirklichkeit. Zwar ruft sie mit
einem trotzigen Dennoch aus: "Mein Fretow, sei getrost! Dein Lob
soll ewig stehn..." Doch es handelte sich um das Auflodern eines
Feuers, das schnell verlöschen sollte. Die Kraftreserven der Dichterin
hatten sich erschöpft.
Ungeachtet ihres leidvollen Erlebens finden sich in Sibyllas Texten nicht nur Klagelieder und Trauergesänge, sondern ebenso ausgelassen-heitere, ja verwegene Gelegenheitsgedichte. Ein Band mit ihren Arbeiten erschien erst zwölf Jahre nach dem Tod der Dichterin - 1650 im fernen Danzig
In Schumachers Buch klopft Martin Opitz kurze Zeit, nachdem die knapp
Siebzehnjährige gestorben war, ahnungslos an die Tür des Schwarz'schen
Hauses und wünscht die junge Poetin zu sprechen. Eine Erfindung des
Autors, in Wirklichkeit ist es nicht dazu gekommen. Aus mindestens zwei
Gründen ein legitimes literarisches Verfahren: Zum einen gilt nach
wie vor Opitz' Feststellung, dass "die ganze Poeterey [...] die Dinge
nicht so sehr beschreibe, wie sie sein, als wie sie etwan sein könnten
oder sollten." Zum anderen hatte der Schlesier in der Tat geplant,
Sibylla während einer seiner Reisen nach Westeuropa in Greifswald
zu besuchen. Jahrzehnte später erinnerte Daniel Georg Morhof, Verfasser
der ersten kritischen Literaturgeschichte in Deutschland, in ehrendem
Gedenken an die unvergessene Dichterin: "Sibylla Schwarz [...] war
ein Wunder ihrer Zeit/ denn sie hat von dem dreizehnten Jahre ihres Alters
[...] Verse geschrieben/ die vor solche zarte Jugend [...] unvergleichlich
sind."
Am Ende der Romanbiographie drückt Opitz seine Hoffnung aus, die
Greifswalder wüssten um "den unschätzbaren Verlust, den
die Poesie in Pommern mit dem Tod Sibyllas erlitten hat." Trügt
nicht aller Anschein, könnte sich diese Hoffnung allmählich
erfüllen.
Greifswald, August 2007
(Gekürzte Fassung bei der Buchpremiere am 31. August im Greifswalder
Dom vorgetragen.)