V. ADDENDA
5. Sibylla Schwarz: GESANG WIDER DEN NEID. Barockdichtung aus Greifswald.
Herausgegeben von Horst Langer. Karl-Lappe-Verlag. Greifswald 2013.
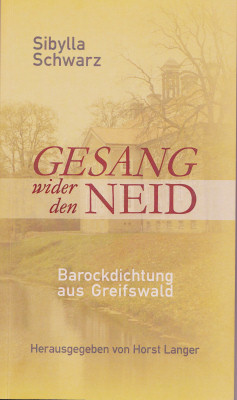 |
Soll mich dann nun der Neid betrügen,
mich, die kein Tod abschrecken kann? Soll mich die Welt mit ihren Lügen jetzt führen eine fremde Bahn? Der Neid, der sonst die Liebe bricht, Der bricht doch meine Liebe nicht. Sibylla Schwarz |
Aus dem Vorwort der Ausgabe:
Geboren 1621, kurze Zeit, nachdem der kontinentale dreißigjährige
Krieg (1618-1648) seinen verhängnisvollen Anfang genommen hatte,
wuchs Sibylla bis zu ihrem sechsten Jahr wohlbehütet auf. Danach
ging es Schlag auf Schlag. Im November 1627 erfolgte der Einzug kaiserlicher
Truppen in Greifswald - mit einschneidenden Konsequenzen sowohl für
die Stadt als auch für die Familie des Ratsmitglieds und späteren
Bürgermeisters, die sich einer Einquartierung nicht entziehen konnte.
(...)
Vor dem Hintergrund der existenziell bedrohlichen Erlebnisse schienen persönliche Verluste und Enttäuschungen im profanen Alltag fast zu verblassen - aber eben nur fast. Verstellung und Intrigen im Miteinander respektive Gegeneinander der Menschen, der Abschied von Freunden und wohl auch erste quälerische Erfahrungen unerfüllten Verliebtseins sowie nicht zuletzt die Verleumdung ihrer literarischen Bemühungen, um die vor allem anderen Sibyllas Denken und Empfinden kreiste - so kam eins zum anderen und formte das Verhältnis der jugendlichen Dichterin zu Gott und der Welt. Gleichsam im Zentrum dieser Gemengelage stand für Sibylla das Phänomen NEID, eine der sieben Todsünden, die nach christlicher Überlieferung durch den Teufel in die Welt gekommen ist, laut Bibel zur Natur des Menschen gehört (Sprüche 14,30 und 23,6; Sirach 14,10 sowie 31,14), sich in Missgunst, Hass, ja sogar in Mord und Totschlag (1 Samuel 18,9; Genesis 4,3 ff. und 37,4) äußern kann und das Zusammenleben von Menschen wie großer Gemeinschaften belastet oder gar zerstört. Das Alte Testament erwartet die Überwindung von Neid durch ein allzeit gelassenes Herz, das Sich-Fernhalten von Neidern, durch Zufriedenheit und Mäßigung (Sprüche 14,30 und 23,6; Sirach 14,10 und 31,14). Nach dem Neuen Testament kann Neid durch ein Leben im Geist (Galater 5,22.24) sowie durch Weisheit (Jakobus 3,17 f.) und tätige Liebe (1 Korinther 13,4 ff.) überwunden werden.
Immer wieder thematisierte Sibylla den Topos, erhob ihn zu einem "Fahnenwort" ihres terminologischen Repertoires, Ausdruck und Signal dafür, in welchem Maße sich Gott im Tun und Lassen der Zeitgenossen nicht allein nach Auffassung der Dichterin verleugnet fand. Der Begriff begegnet bereits im ersten Gedicht der Ausgabe von 1650, das unter dem programmatischen Titel steht "Ein Gesang wider den Neid". (...)
Der Band folgt dem Ziel, literarische Texte zu präsentieren, deren
Lektüre gleichermaßen informativ und vergnüglich ist -
gemäß dem seit der Antike von dem römischen Dichter und
Gelehrten Horaz (65 - 8 v. Chr.; ars poetica = Dichtkunst, Vers 333) überlieferten
Selbstverständnis der Opitz-Schule, "Unterricht, auch Ergötzung"
der Leser seien "der Poeterey vornehmster Zweck" (Martin Opitz,
Buch von der Deutschen Poeterey, 1624). Mehr als einmal hat sich Sibylla
zu diesen Maximen auch ihres Schreibens bekannt.
"Kann man beim heutigen Lesepublikum ein über rein wissenschaftliche
Fragestellungen hinausgehendes Interesse an Barocklyrik wecken? Der Herausgeber
des vorliegenden Lyrikbändchens, Horst Langer, unternimmt einen solchen
Versuch. ... Ob dieses Unterfangen gelungen ist, ließe sich wohl
nur durch eine Befragung der Leser ermitteln. Man hätte es aber kaum
besser und erfolgversprechender angehen können. ... Die Auswahl der
Gedichte liefert einen guten Querschnitt der barocken Formen und Themen
der Dichterin. Horst Langer ist eine außerordentlich ansprechende
Edition gelungen, der sehr zu wünschen ist, daß sie das angestrebte
'literarisch und historisch interessierte breitere Publikum erreichen
wird. Da der Band zu einem sehr günstigen Preis angeboten wird, stehen
die Chancen dafür gar nicht schlecht'." Dr. Ralf Schuster in:
Informationen aus dem Ralf Schuster Verlag. Aufsätze, Rezensionen
und Berichte aus der germanistischen Forschung, Heft 8. Passau 2014.